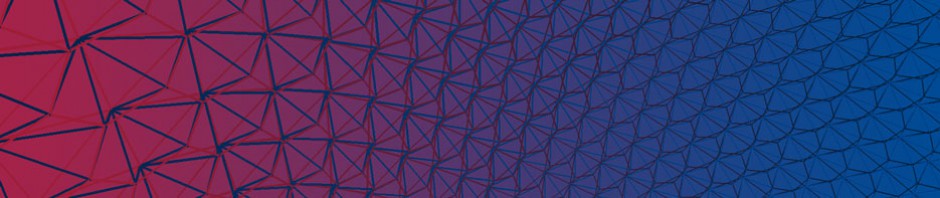Warum in die Sahara? Meine Überlegung war einfach: Gerade in einer Wüste müsste ein mit Sonnenenergie betriebenes Luftschiff lange ausharren können, dort würde uns niemand suchen, und wenn uns doch jemand finden sollte, wäre es für ihn nicht leicht, dorthin zu kommen. Wir würden sicher sein, jedenfalls solange unsere knappen Lebensmittelvorräte reichten. Das begrenzte die Zeitspanne, die uns zur Verfügung stand, um die Hyperborea fertigzustellen.
Mein konkretes Ziel: die weitere Umgebung im Länderdreieck zwischen Mali, Niger und Algerien – dort, wo es in der Sahara am trockensten ist; dort, wo der Boden nicht aus Sand, sondern aus Steinen und Felsen besteht, wo nicht einmal auf einem Kamel oder zu Pferde ein Durchkommen ist, in der Hammada, wo es in tausend Kilometern Umkreis keine Oase gibt, nordöstlich des bereits vor über vier Jahrhunderten untergegangenen Songhaireiches mit seiner berühmten Hauptstadt Timbuktu. Die Helden der Comics meiner Kindheit flohen gleichermaßen immer dorthin, meistens am unglücklichen Ende der jeweiligen vermasselten Geschichte.
Diese Variante schien mir sicherer zu sein, als auf offener See zu arbeiten, wie Herr Augsburger vorschlug. Schiffe würden uns eher ausmachen als Satelliten, bekräftigte die Mehrheit meiner Mitreisenden mich: Schiffe fuhren und trieben wahllos durch die Meere und konnten uns überall zufällig entdecken, Satelliten schauten auf andere Gebiete, denn diejenigen, die sie steuerten, hatten nichts mit der zentralen westlichen Sahara am Hut. Kein Wasser unter uns zu haben, war sicherer. Auf die Weise konnten wir uns zwischenzeitlich die Beine vertreten, uns gegenseitig aus dem Weg gehen, was in unserer psychologisch angespannten Situation auch ratsam erschien. Unser eigenes Wasser bezogen wir aus der Linde-Maschine, selbst in der Wüste kann man Wasser aus der Luft kondensieren ebenso wie CO2. Daraus machte ich Trockeneis und lagerte dieses Abfallprodukt in dem Raum mit der Flüssigluft ein, anstatt es wegzuwerfen, was auf den ersten Blick als das Einfachste erschien. Im Laufe der Zeit sammelte sich eine beträchtliche Menge CO2 an, ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Zunächst dauerte es lange, bis die Menge nennenswert erschien: Der CO2-Gehalt der Atmosphäre liegt nur im ppm-Bereich. Wir bauten drei lange Wochen weiter, bis die Hyperborea fertig war oder, genauer gesagt, bis sie uns fertig genug für unsere Ungeduld vorkam. Was wir in der Zeit über die Augen sahen, die weiterhin ihre Bilder übertrugen, erfüllte mich mit Sorge und Angst; vor der Crew hielt ich den Großteil des Geschehens zurück, so weit es ging. Sie merkten ohnehin, dass die Lage besorgniserregend war.
Die Linde-Maschine lief tagsüber, von der gnadenlosen Sonne gespeist, auf Hochtouren. Die flüssige Luft war in unserer Situation den Akkus und den Kapazitatoren vorzuziehen, weil wir mit ihrer Hilfe unsere Wasserversorgung sicherstellten. Hierbei fielen täglich knapp fünfundachtzig Gramm CO2 an, achtzig Liter Wasser und zwölfhundert Liter flüssiger Luft an. Nachts wandelten wir die flüssige Luft in Strom um, wir konnten lange bei künstlichem Licht arbeiten und es blieb eine täglich wachsende Reserve flüssige Luft übrig. Sie reichte sogar, um zahlreiche Räume der großen Luftjacht zu kühlen. Hätten wir noch größere Flüssiglufttanks gehabt, hätten wir die Luft als Ballast benutzen können. Zum Glück hatten wir einige Tonnen Meerwasser als zusätzliche Ladung im Atlantik getankt. In kleinen Mengen dem destillierten Wasser aus der Luft hinzugemischt machte es dieses trinkbar, sonst hätte das auf die Art gewonnene Wasser uns natürlich die Innereien verätzt; gut, dass wir daran noch gedacht hatten. Leider vermehrten sich die Wasservorräte, die viel effektiveren Ballast bildeten, nicht so schnell wie die Energievorräte und diese wuchsen nur so schnell, weil es in der Hitze bisher sehr windstill war und wir die Hyperborea nicht von der Stelle bewegten. Augen und Vendobionten achteten aus der Höhe um uns herum auf das Wetter und übertrugen uns ihre Daten. Ein Sandsturm wäre schlecht, aber mittlerweile würden wir ihm, sofern wir ihn früh genug bemerkten, entkommen können, schätzte ich. Des Weiteren achteten die Vendobionten und vor allem die Augen weiter draußen in der Welt auf alles was es sonst so gab und passierte. Und das sah gar nicht gut aus.
zurück • vor